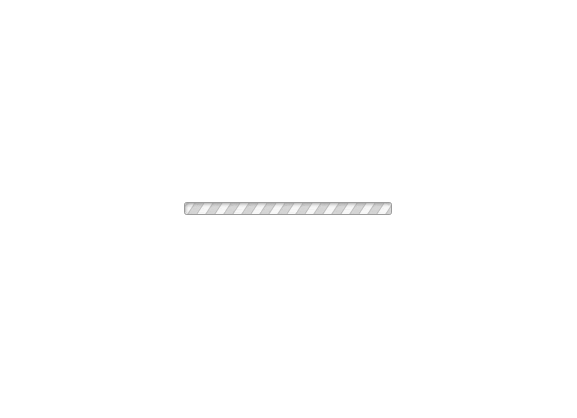Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts
Rede von Außenminister Frank-Walter Steinmeier im Deutschen Bundestag zum Gedenken an die Opfer des Völkermordes in Ruanda
„Die Berge Ruandas strömen Wärme und Behaglichkeit aus. Sie locken durch Schönheit und Stille, kristallene Luft, Ruhe und die Vollkommenheit ihrer Linien und Formen. Am Morgen füllt durchsichtiger Nebel die grünen Täler.“
Herr Präsident,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
So beschreibt Richard Kapuscinski die Landschaft von Ruanda. 'Land der tausend Hügel' wird Ruanda im Volksmund genannt.
Einer der tausend Hügel liegt in Murambi. Hierhin waren zehntausende Tutsi geflüchtet, als vor 20 Jahren der Massenmord in Ruanda begann.
'Oben am Hügel, in der neu gebauten Schule seid ihr sicher', hatte der Bischof gesagt.
Doch am frühen Morgen des 21. April 1994 umstellten Milizen die Schulgebäude und begannen zu morden – mit Macheten, Messern und Knüppeln, ein Blutrausch, der kein Ende nehmen wollte.
Zehntausende Menschen starben auf diesem Hügel an einem einzigen Tag.
Jonathan Nturo hat das Massaker als kleiner Junge überlebt. Heute sagt er beim Blick über den Hügel: „Ich wundere mich manchmal, dass hier noch Gras wächst. Dass das Leben weitergeht.“
Ja, es ist schwer zu begreifen, dass die Erde sich weiter dreht nach dem Grauen des Völkermords.
Ein solches Gefühl hat mich ergriffen, als ich zum ersten Mal Bergen-Belsen, Buchenwald und Auschwitz besucht habe. Und es beschleicht wohl jeden, der an diese Orte kommt. Aber auch dort wächst noch das Gras. Jetzt im Frühling blühen sogar die Bäume.
Als Deutscher bin ich vorsichtig mit historischen Vergleichen. Sie werden der Einzigartigkeit und Unvergleichbarkeit dieser Verbrechen nicht gerecht. Sie werden der Einzigartigkeit von Geschichten und Kulturen nicht gerecht.
Und dennoch: Als Deutscher kann ich von einem Völkermord in Afrika nicht sprechen, ohne des von uns selbst verantworteten zu gedenken. Dies sind Schicksalsmomente unserer Kontinente. Sie prägen unser Handeln bis heute, und sie prägen unsere Beziehungen miteinander.
Unsere Schicksalsmomente mögen so unterschiedlich sein wie ihre Landschaften: die Hügel von Ruanda, die Wälder um Auschwitz, die Mohnfelder von Verdun. Doch die Lehren aus diesen Schicksalsmomenten verbinden uns. Sie sind Lehren unserer geteilten Menschlichkeit.
Die eine Lehre, die an einem Gedenktag wie heute am lautesten ertönt, heißt:
Niemals wieder!
Ja, niemals wieder. Doch viel schwieriger ist die Frage, wie wir dieser Verantwortung gerecht werden.
Denn seien wir ehrlich: Schon einmal hat die internationale Völkergemeinschaft schon einmal laut „Nie wieder!“ gerufen. Das war 1948, nach dem Holocaust, als die Vereinten Nationen die Völkermord-Konvention beschlossen. Doch das Versprechen haben wir nicht halten können. Die internationale Gemeinschaft hat versagt, als sie in Ruanda inmitten der Gewalt ihre Blauhelmsoldaten abzog.
Und zur Wahrheit gehört auch, dass heute, in der Gegenwart, die Dämonen des Völkermords keineswegs gebannt sind.
Auch wenn die Internationale Gemeinschaft unter der Überschrift „Responsibility to Protect“ auf Ruanda reagiert hat, auch wenn sie Prävention und Einsatzfähigkeit und internationale Strafgerichtsbarkeit verbessert hat. Wir sprechen nicht überall von Völkermord, aber wir stehen im Kongo, in Zentralafrika oder in Syrien vor endlosem Blutvergießen.
Jonathan Nturo und allen anderen Opfern von Menschheitsverbrechen können wir den Verlust ihrer Kinder, Väter, Mütter und Freunde nie wieder gut machen. Aber wir schulden ihnen etwas, auch wenn wir ehrlich wissen, dass wir nicht jedes Unrecht und Blutvergießen stoppen können: Wir schulden ihnen, dass wir uns nicht dem Gefühl der Ohnmacht und schon gar nicht der Gleichgültigkeit hingeben– dass wir nicht nur anprangern, sondern das tun, was in unser Macht steht, um Völkermord zu verhindern!
Ruanda ist dabei, Vergangenheit aufzuarbeiten, ein neues Ruanda zu schaffen. Überall in Afrika entsteht ganz viel Neues in diesen Jahren. Afrika verändert sich schneller als unsere Wahrnehmung von Afrika.
Das ist der Grund für meine Reise nach Äthiopien, Tansania und Angola in der vergangenen Woche. So verschieden diese Länder sind, so habe ich doch überall, von fast allen Gesprächspartnern, denselben Ruf gehört. Der Ruf lautet: Wir wollen keine Bettler vor den Türen Europas sein. Der afrikanische Kontinent ist aus sich heraus lebensfähig, kann Nahrung und Entwicklung für alle Menschen jedenfalls potenziell bereitstellen.
Wenn es um Stabilität und Frieden geht, sagen viele: Wir Afrikaner wollen unsere Sicherheit in die eigenen Hände nehmen! Wir wollen nicht um Europas Soldaten bitten, sondern wollen das selbst bewältigen können, selbst handeln können.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, das muss eben auch unser Interesse sein. Natürlich wollen auch wir Europäer, dass Afrika sein Schicksal in die eigenen Hände nimmt. Afrika ist ein Kontinent im Aufbruch, und wir müssen diesen Aufbruch massiv unterstützen.
Mehr und mehr müssen wir Europäer die Staaten in Afrika als Partner verstehen. Wir brauchen Partner für die globalen Herausforderungen, vor denen wir gemeinsam stehen und von denen wir ganz genau wissen, dass wir sie auch nur gemeinsam lösen können.
Auf beiden Seiten merken wir doch, wie nah unsere Kontinente aneinander gerückt sind. Wie sehr wir von der Stabilität des anderen abhängen. Das erleben wir Europäer zum Beispiel, wenn Flüchtlinge aus Afrikas Krisenherden an Europas Grenzen stoßen. Und das spüren Afrikaner, wenn die Wirtschaftskrise in Europa auch in Afrika ihre Spuren hinterlässt.
Das Ziel ist leicht beschrieben: starke, verantwortliche Partner in Afrika. Aber der Wege gibt es viele.
Afrika entwickelt sich viel zu rasant und zu vielfältig, als dass wir unserem politischen Engagement eine knackige Überschrift geben könnten. So sehr Politik und Medien solche Überschriften suchen– Afrika ist weder einfach Krisenkontinent noch einfach Chancenkontinent. Wahrscheinlich hat Horst Köhler recht: Solche Urteile sagen ohnehin viel mehr über uns selbst als über Afrika.
Ich finde: So vielfältig die Entwicklung Afrikas, so vielfältig muss der Instrumentenkasten unserer Politik sein.
Je nach Land und je nach Lage gehören in diesen Instrumentenkasten wirtschaftliche Investitionen genau wie Abrüstung und die Eindämmung von Kleinwaffen; kultureller Austausch genau wie Straßenbau; die Stärkung des Rechtsstaats genau wie das Training von Sicherheitskräften.
All diese Instrumente habe ich auf meiner Reise gesehen, und sie alle werden sich wiederfinden in den afrikapolitischen Leitlinien der Bundesregierung, die wir gerade erarbeiten.
Außenpolitik ist ein Balanceakt zwischen der Suche nach Gemeinsamkeiten und dem Respekt vor unseren Unterschieden – auch der Feststellung dessen, was unvereinbar ist.
Unsere Gemeinsamkeiten mit Afrika –das habe ich auf meiner Reise deutlich gespürt– gehen weit über das reine 'Nie-Wieder' von Krieg und Völkermord hinaus.
Erstens, Europäer wie Afrikaner haben gelernt, mit unseren Nachbarn zu arbeiten statt gegen sie. Das ist die Leitidee der regionalen Integration.
Ich befürchte, wir unterschätzen gelegentlich, was von den afrikanischen Organisationen mittlerweile geleistet wird. Viele wissen einfach nicht, dass die Afrikanische Union 70 000 Soldaten in innerafrikanischen Konflikten im Einsatz hat und mit Mühe ‑ und nicht überall erfolgreich ‑ dort Stabilität wiederherzustellen sucht, wo sie verloren gegangen ist. Die Stärkung der afrikanischen Eigenverantwortung, die dazu notwendig ist, hat auf dem EU-Afrika-Gipfel in dieser Woche eine große Rolle gespielt.
Wir Deutschen tun das ganz konkret, zum Beispiel indem wir das Kofi Annan International Peacekeeping Training Centre in Ghana unterstützen oder das Peace and Security Centre ‑ ich konnte mir das ansehen ‑, das wir auf dem Gelände der Afrikanischen Union in Addis Abeba bauen und das nächstes Jahr eröffnet wird, pünktlicher als manche Baustelle in Deutschland.
Zweitens, wir haben gelernt, die Vielfalt der Menschen zu schützen.
Die Botschafterin Ruandas in Deutschland hat in Ihrer Rede zum Auftakt des 20-jährigen Gedenkens an den Völkermord gesagt: „Wir bauen ein Ruanda auf, in dem alle Menschen […] sich mit gleichen Rechten entfalten können“.
In Vielfalt leben – das geht nur in einem Rechtsstaat, auf den alle Menschen sich verlassen können. Zu dieser Vielfalt –davon bin ich überzeugt– gehört die Freiheit von Meinung oder Religion genau wie die Freiheit der sexuellen Orientierung.
Auch das war ein Grundsatz, der auf jeder einzelnen Station meiner Reise eine Rolle spielte. Zum Beispiel bei meinem Besuch am German Tanzanian Law Centre in Daressalam, wo ich Studenten getroffen habe, die hoffentlich eines Tages den Rechtstaat in Ostafrika prägen werden. Viele ihrer Lehrer haben an deutschen Universitäten studiert. Deshalb will ich an dieser Stelle den vielen deutschen Universitäten meinen herzlichen Dank für ihr Engagement auf dem afrikanischen Kontinent aussprechen, insbesondere dem Deutschen Akademischen Austauschdienst, der sich durch seine Stipendienprogramme mit unendlicher Energie für diese Zusammenarbeit einsetzt.
Und drittens haben wir gelernt, dass Frieden oder Unfrieden auch materielle Grundlagen hat – insbesondere dann, wenn sie fehlen.
Der Völkermord vor 20 Jahren wurde angeheizt durch materielle Not und knappe Ressourcen – Konflikte, die die Machthaber systematisch ausnutzten, um möglichst viele Menschen in das Morden zu verstricken.
Deshalb gehört zu den Lehren des Völkermords das Friedensversprechen ebenso wie das Wohlstandsversprechen. Sie sind nicht ohne einander denkbar.
Kongo, Nigeria und Angola – Alle diese Staaten lehren uns, dass Öl, Gas, Gold und Diamanten nicht von selbst für Wohlstandsentwicklung sorgen, an der alle teilhaben. Sondern das muss politisch organisiert werden.
Nur wenn der wirtschaftliche Aufbruch Perspektiven für alle Menschen schafft, nur wenn er –durch Bildung, Arbeit und Gesundheit‑ alle Menschen am Wohlstand teilhaben lässt, schweißt er die Gesellschaft zusammen. Nur dann sorgt er für Frieden.
Das doppelte Versprechen von Frieden und Wohlstand schulden wir niemandem so sehr wie unseren jungen Menschen.
Einen Eindruck meiner Afrika-Reise werde ich nicht vergessen. In Addis Abeba traf ich die Vorsitzende der Kommission der Afrikanischen Union, Frau Dlamini-Zuma. Nach unserem Gespräch stellte ihr eine Journalistin eine klare Frage: „Was ist die größte Erwartung Afrikas an Europa?“
Und was für Politiker ja nicht gerade typisch ist: Frau Zuma gab eine genau so klare Antwort. Sie sagte: „Unsere Jugend! Für sie wollen wir mit Europa arbeiten, für ihre Ausbildung, für ihre wirtschaftliche Perspektiven.“
Daraufhin stellte die Journalistin genau die umgekehrte Frage: „Und was hat Europa von Afrika zu erwarten?“
Und wieder sagte Fr. Zuma: „Unsere Jugend! Unsere Jugend ist unser Reichtum, und von diesem Reichtum wird auch Europa profitieren.“
Meine Damen und Herren,
die Lehren aus unseren Schicksalsmomenten verbinden uns. 20 Jahre nach dem Völkermord ist Ruanda ein Land, das auf dem Weg ist in eine neue Zukunft, ohne zu verdrängen, ohne zu vergessen.
Die tausend Hügel von Ruanda sind und bleiben eine Schicksalslandschaft Afrikas.
Roméo Dallaire, der 1993 als Kommandeur der Blauhelme nach Ruanda kam, rief, als er die tausend Hügel sah: 'ein Garten Eden ist das hier'. Wenige Monate später musste er voll Scham und Wut das Massaker mit ansehen.
Die Erinnerung ist den tausend Hügeln eingeprägt. Ihr Name bleibt verbunden mit dem Menschheitsverbrechen vor 20 Jahren.
Liebe Kolleginnen und Kollegen:
Neben aller Erinnerung, die in dieser Landschaft ruht – Denen, die Ruanda heute aufbauen, mögen die tausend Hügel wieder Heimat sein und ein fruchtbarer Boden.