Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts
Gemeinsam den sozialen Dialog in Europa stärken
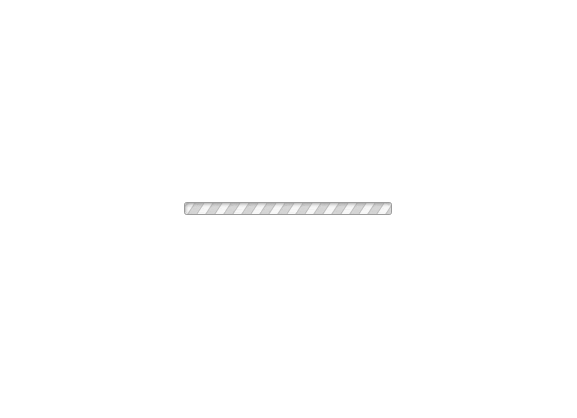
ein Stahlarbeiter im Schutzanzug entnimmt eine 1500 Grad heiße Roheisenprobe, © Rupert Oberhäuser/picture alliance
Die Funktionsfähigkeit des sozialen Dialogs hat große Auswirkungen auf die Wirtschaft. Im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft wurde nun ein Statusbericht erstellt, der die weiterhin großen Unterschiede zwischen den EU-Mitgliedsstaaten feststellt.
Der soziale Dialog zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern ist ein zentrales Element der deutschen sozialen Marktwirtschaft. Das System der Mitbestimmung und der tariflichen Einigungen prägt das deutsche Wirtschaftssystem. Auf europäischer Ebene wurde der soziale Dialog mit dem Maastrichter Vertrag im Jahr 1992 institutionell verankert. Gerade in Zeiten der Krise erhöht sich der Druck auf die Wirtschaft – und somit auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Damit gewinnt der soziale Dialog weiter an Bedeutung. Hierzu sagte Staatsminister Niels Annen:
Das Arbeitsleben hat sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten tiefgreifend geändert. Neue Arbeitsformen haben sich entwickelt. Das Regelungswerk der Mitbestimmung hingegen ist weitgehend noch im industriellen Zeitalter entwickelt worden. Die in der Europäischen Union bekannten Systeme der Beteiligung im Arbeitsleben sind überwiegend vor 50 Jahren entstanden. Sie bedürfen daher in manchen Bereichen einer Überarbeitung und Anpassung.
Das europäische Mosaik des sozialen Dialogs
Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft hat sich auch zum Ziel gesetzt, das soziale Europa zu stärken. Deswegen hat Deutschland eine Studie des „Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss“ (EWSA) initiiert, die den Zustand des sozialen Dialogs in den einzelnen EU-Mitgliedsländern wie auch in den Abläufen der EU analysiert. Zudem werden die Herausforderungen für den sozialen Dialog untersucht. Der Bericht zeigt, dass die Unterschiede in der EU weiterhin groß sind: In 18 von 27 EU-Staaten existieren Formen des „sozialen Dialogs“. Damit fehlen in einem Drittel der Mitgliedsstaaten diese Strukturen vollständig. In einzelnen Mitgliedsstaaten sind sie zudem nur sehr schwach ausgeprägt.
Der Bericht weist darauf hin, dass der soziale Dialog auf nationaler und europäischer Ebene eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung der Wirtschafts-, Arbeits- und Sozialpolitik spielt und zu einer Verbesserung von Lebens- und Arbeitsbedingungen beiträgt. Die Einbeziehung der Sozialpartner habe sich im Laufe der Zeit verbessert, sei aber noch nicht so wirkungsvoll wie erforderlich. Gerade in der Phase der wirtschaftlichen Erholung nach der Covid-19-Krise bedürfe es einer substanziellen Einbindung der sozialen Partner.
Wie geht es nun weiter?
Der Bericht bildet die Grundlage für die Ausarbeitung weiterer Schritte zur Stärkung partizipativer Strukturen in Europa. Dafür müssen alle beteiligten Akteure aus Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft eingebunden werden. Am 10. November eröffnet Staatsminister Niels Annen die Debatte im Rahmen einer virtuellen Konferenz zu „Social dialogue as an important pillar of economic sustainability and the resilience of economies in Europe“. Seine Rede können Sie Rede von Staatsminister Niels Annen bei der Online-Konferenz „Social dialogue as an important pillar of economic sustainability and the resilience of economies in Europe“ nachlesen.
Die Förderung des sozialen Dialogs in globalen Lieferketten und multinationalen Unternehmen gehört auch zu den Zielen des Engagements des Auswärtigen Amtes im Bereich der Menschenrechte.
Weitere Informationen
Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss