Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts
Jahresabrüstungsbericht 2022
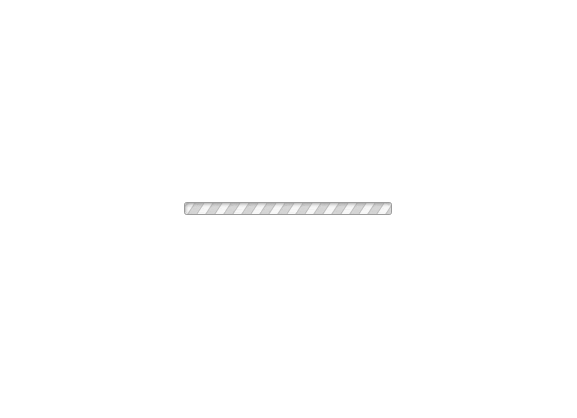
The European Space Agency’s earth observation satellite Sentinel‑1B in space, © ESA/ATG medialab
Trotz äußerst schwieriger, internationaler Rahmenbedingungen hat sich die Bundesregierung auch im Jahr 2022 für die Stärkung der internationalen Rüstungskontroll- und Abrüstungsarchitektur eingesetzt. Eine Übersicht über Initiativen, Rückschläge und Reflexion.
Die Bundesregierung hat den Jahresabrüstungsbericht 2022 am 26.04.2023 im Bundeskabinett beschlossen. Der Bericht beleuchtet die wichtigsten Abkommen und Bestimmungen, zentrale Entwicklungen und die Schwerpunktsetzung der deutschen Rüstungskontroll-, Abrüstungs-, und Nichtverbreitungspolitik im Jahr 2022.
2022: Ein Jahr des fortgesetzten Engagements
Die Bundesregierung hat im Jahr 2022 unter widrigen Bedingungen international Verantwortung für Rüstungskontrolle, Abrüstung und Nichtverbreitung übernommen. Einen wichtigen Meilenstein setzte im August 2022 die 10. Überprüfungskonferenz des Nichtverbreitungsvertrages in New York, die Außenministerin Baerbock für die Bundesregierung wahrnahm. Die Bundesregierung brachte mit ihren Partnern der Stockholm-Initiative und der Nichtverbreitungs- und Abrüstungsinitiative (NPDI) Vorschläge zur Risikoreduzierung und Abrüstungsverifikation ein. Alle internationalen Anstrengungen für ein gemeinsames Abschlussdokument scheiterten aber letztlich an der Blockade Russlands gegen den Wunsch von allen anderen Teilnehmerstaaten.
Im Juni nahm die Bundesregierung als Beobachterin an der ersten Vertragsstaatenkonferenz des Atomwaffenverbotsvertrages (AVV) in Wien teil. Damit trug sie der Tatsache Rechnung, dass sie die Sorge um den Stillstand der nuklearen Abrüstung teilt.
Den Vorsitz der G7 nutzte Außenministerin Baerbock, um sich gemeinsam mit dem Leiter der Internationalen Atomenergiebehörde IAEO, Grossi, für die Sicherheit und Sicherung ukrainischer Atomkraftwerke einzusetzen. Dies trug zu einer Stabilisierung insbesondere der Lage um das Kraftwerk in Saporischschja bei. Als G7-Präsidentschaft hatte Deutschland 2022 auch den Vorsitz der Globalen Partnerschaft (GP) gegen die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen inne. Auf deren Herbsttagung im Auswärtigen Amt wurden unter anderem „Berliner Handlungslinien“ zur Biosicherheit verabschiedet.
Auf der 9. Überprüfungskonferenz des Übereinkommens über das Verbot biologischer Waffen (BWÜ) im Dezember 2022 gelang es, trotz russischer Desinformation eine Arbeitsgruppe zur dringend nötigen Stärkung des Abkommens einzusetzen.
Im Bereich Weltraumsicherheit gelangen Fortschritte auf dem Weg zu einer internationalen Ächtung erdgestützter destruktiver Anti-Satelliten-Tests. 2022 verpflichteten sich neben Deutschland auch Frankreich, Japan, Kanada, Neuseeland, die USA und das Vereinigte Königreich, solche Tests künftig nicht durchzuführen. Deutschland hat solche Tests auch zuvor schon nicht durchgeführt.
Einen Schwerpunkt legte die Bundesregierung im Bereich Cyber. Gleiches galt für ihren Einsatz zur Kontrolle Letaler Autonomer Waffensysteme (LAWS). In den Vereinten Nationen (VN) gelang im Juli 2022 auf deutsche Initiative eine Einigung auf die Schaffung eines weltweiten Kontaktnetzes zum Austausch über cyberpolitische Fragen. Wichtige Impulse gingen von einer internationalen Cyberkonferenz im September 2022 aus, zu der Außenministerin Baerbock einlud.
Im November 2022 übernahm Deutschland die Präsidentschaft der Ottawa-Konvention zur weltweiten Ächtung von Antipersonenminen. Sie konnte die von Deutschland angestoßene Initiative zur Eindämmung der illegalen Proliferation von Munition in den Vereinten Nationen voranbringen.
Ein Jahr der Rückschläge
Russlands völkerrechtswidriger Angriffskrieg gegen die Ukraine hat die über Jahrzehnte gewachsene konventionelle und nukleare Rüstungskontrolle in Europa schwer beschädigt. Seit dem 24. Februar 2022 hat Moskau wiederholt unverantwortliche nukleare Drohungen ausgesprochen. Neben konventionellen Angriffen hat es Cyberattacken und Desinformationskampagnen in nie dagewesenem Umfang durchgeführt.
Anlass zu großer Sorge boten 2022 auch die ungelösten Proliferationskrisen, die aus den iranischen und nordkoreanischen Nuklearprogrammen erwachsen. Iran hat sein Nuklearprogramm ausgebaut und seine Anreicherungs- und Entwicklungsaktivitäten deutlich vorangetrieben. Nordkorea hat seine Trägersysteme weiterentwickelt, seine Nukleardoktrin verschärft und angekündigt, sein Nuklearwaffenarsenal erheblich auszuweiten. Es hat 2022 präzedenzlose 35 Testserien verschiedener ballistischer Raketentypen durchgeführt und bedroht Stabilität und Frieden in der Region.
Ein Jahr der Reflexion
Die Bundesregierung hat den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und die vorausgehende Verletzung internationaler Rüstungskontrollverträge durch Russland zum Anlass genommen, ihre Bemühungen um Rüstungskontrolle, Abrüstung und Nichtverbreitung im Dialog mit ihren Partnern zu überdenken. Außenministerin Baerbock hat sie im März 2023 in ihrer Rede vor der Genfer Abrüstungskonferenz unter anderem zwei Aspekte formuliert:
- Die Bundesregierung begreift Rüstungskontrolle unter den neuen Umständen noch stärker als integralen Teil von Sicherheitspolitik. Fähigkeiten der NATO auszubauen und die Resilienz der Ukraine zu stärken, steht nicht im Widerspruch dazu, sich für Rüstungskontrolle in Europa und darüber hinaus einzusetzen. Beides bedingt einander und dient komplementär demselben Ziel, Sicherheit zu erhöhen.
- Zweitens müssen alle Bemühungen um Rüstungskontrolle, Abrüstung und Nichtverbreitung dem Umstand Rechnung tragen, dass gegenüber Russland in massivem Ausmaß Vertrauen verloren gegangen ist. Umso dringender bedarf es einer Verminderung von Risiken und Vermeidung unbeabsichtigter Eskalation, um ein Mindestmaß an Sicherheit herzustellen.