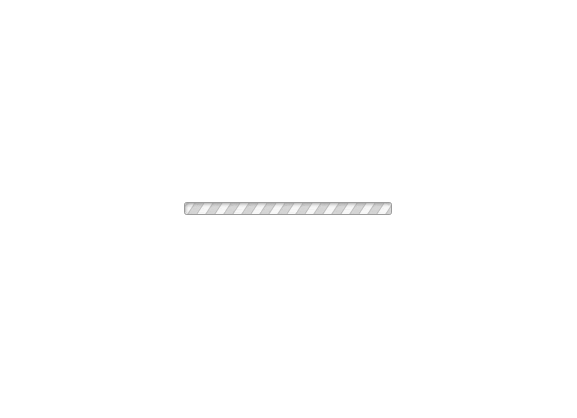Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts
Außenminister Maas zum 30. Jubiläum des deutsch-polnischen Vertrages über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit vom 17. Juni
Zum 30. Jubiläum des deutsch-polnischen Vertrages über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit vom 17. Juni 1991 sagte Außenminister Maas heute (17.06.):
Aussöhnung und Neuanfang mit Polen – dafür steht der deutsch-polnische Nachbarschaftsvertrag vom 17. Juni 1991. Wir Deutsche sind unseren Nachbarn und Freunden sehr dankbar, dass sie uns im Angesicht unserer sehr leidvollen Geschichte vor 30 Jahren die Hand ausstreckten. Eine Geste, die uns demütig macht, angesichts der grausamen Verbrechen, die Deutschland im Zweiten Weltkrieg an Polinnen und Polen verübt hat. Nachdem die deutsch-polnischen Beziehungen vor allem durch schmerzhafte Erinnerung an Tod und Vernichtung durch deutsche Hand geprägt wurden, legte der Nachbarschaftsvertrag den Grundstein für einen Neuanfang und Aufbruch, als Freunde in einem vereinten und freien Europa.
Heute sind die deutsch-polnischen Beziehungen enger und vielfältiger, als je zuvor: Unsere beiden Länder treten für ein starkes, handlungsfähiges Europa ein, das einen stabilen und verlässlichen Pfeiler der widererstarkten transatlantischen Partnerschaft darstellt. Aber vor allem leben, arbeiten und lernen Deutsche und Polen grenzüberschreitend und lassen unsere beiden Länder ganz natürlich weiter zusammenwachsen. Über 850.000 Polinnen und Polen leben in Deutschland, es gibt zehntausende Grenzpendler und tausende Unternehmen, die unsere Wirtschaftsräume auf das Engste verflechten. Und auch die deutsch-polnischen Institutionen, die mit und seit dem Nachbarschaftsvertrag entstanden sind, wie zum Beispiel das Deutsch-Polnische Jugendwerk, stärken das gegenseitige Verständnis und Vertrauen, gerade der jungen Menschen, ineinander.
Beziehungen zwischen Menschen und Staaten haben nur Zukunft, wenn sie das gemeinsame Erinnern in sich tragen. Das Leid der polnischen Zivilbevölkerung im Zweiten Weltkrieg ist stärker in das deutsche Bewusstsein gerückt, der gemeinsame Blick auf die schmerzliche Vergangenheit hat sich einander angenähert. Ich habe selbst auf meinen Reisen nach Polen erlebt, wie präsent die deutschen Gräueltaten sind und wie wenig wir in Deutschland immer noch über einige dieser Verbrechen wissen, deren Wunden bis heute in Polen nicht vollständig verheilt sind. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir in Berlin nun einen Ort des Erinnerns und der Begegnung für polnische Opfer des Zweiten Weltkriegs schaffen. Von diesem Ort soll durch gemeinsames Gedenken auch ein Signal für eine gemeinsame Zukunft ausgehen. Dieser Gedanke war auch im deutsch-polnischen Freundschaftsvertrag von 1991 angelegt. Damals wie heute gilt: Für ein vereintes Europa, für das Zusammenwachsen von Ost und West, ist Polen ein unerlässlicher Partner.
Hintergrund:
Der „Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Polen über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit“ wurde am 17. Juni 1991 durch Bundeskanzler Helmut Kohl und Außenminister Hans-Dietrich Genscher sowie den polnischen Ministerpräsidenten Jan Krzysztof Bielecki und Außenminister Krzysztof Skubiszewski unterzeichnet. Der Vertrag benennt in 38 Artikeln politische, wirtschaftliche und kulturelle Ziele für die Zusammenarbeit. Gleichzeitig ordnet er das bilaterale Verhältnis zwischen Deutschland und Polen in den gesamteuropäischen Kontext ein.
Zusammen mit dem deutsch-polnischen Grenzvertrag von 1990 („Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Polen über die Bestätigung der zwischen ihnen bestehenden Grenze vom 14. November 1990“) bildet der Nachbarschaftsvertrag das Fundament für Aussöhnung, gute Nachbarschaft, Partnerschaft und Freundschaft zwischen Deutschland und Polen nach dem Ende der Teilung Europas. Auf dieser Grundlage konnten sich enge politische, wirtschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle Beziehungen auf vielen Ebenen entwickeln. Die Bundesländer und Woiwodschaften, Kreise und Kommunen in Deutschland und Polen, und in ihnen große Teile der Zivilgesellschaft, leisten durch ihr vielfältiges Engagement wichtige Beiträge.